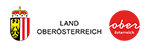Gartentipp Monat Dezember 2024
Dezember 2024

(Quelle: xWilfingerAdobeStock)
Rarität im neuen Glanz
Die Kerbelrübe (Chaerophyllum bulbosum), auch Kälberkropf genannt, wird seit dem 17. Jahrhundert in Europa kultiviert und zeichnet sich durch einen einzigartigen Geschmack aus. Im gekochten Zustand entfaltet sie ihren vollen nussigen Geschmack, der an Maroni und Erdäpfel erinnert. Zum Keimen der Samen ist Frost notwendig. Daher werden sie vor dem Winter ausgesät mit einem Reihenabstand von 30 cm und nur leicht mit Erde bedeckt. Zwischen diesen Reihen kann zum Beispiel mit Laub, Flachsschäben oder Hackschnitzel gemulcht werden. Nach der Keimung im Frühjahr werden die Pflanzen auf 4–6 cm vereinzelt. Je größer der Abstand, desto größer entwickeln sich die Rüben. Diese Pflanzen (vor allem die Sämlinge und Jungpflanzen) mögen Beikräuter überhaupt nicht. Schon im Frühsommer beginnen die Rüben mit dem Verwelken der Blätter. Ab Anfang Juli, wenn die Blätter verschwunden sind, kann geerntet werden. Genussreif werden die Rüben dann im kühlen und trockenen Lager ab Herbst. Wenn die Rüben bis zum Herbstbeginn in der Erde gelassen werden, sollte das Beet mäusesicher sein, um Verluste zu reduzieren. Diese Kultur benötigt weder Dünger noch viel Sonne, aber zu trocken sollte es nicht werden.
Zimmerpflanzen- Gießintervalle und Wassermenge reduzieren
Der Winter ist eine schwierige Zeit für Kübelpflanzen, denn diese werden künstlich in eine Art Ruhephase überführt, da die Temperaturen und Lichtverhältnisse im Garten und am Balkon nicht mehr ausreichend für diese Exoten sind. Meist sind es kühle und möglichst helle Bedingungen, die den meisten Kübelpflanzen-Arten ein Überwintern im Sparmodus ermöglicht. Anders sieht es bei reinen Zimmerpflanzen aus. Sie können bzw. müssen keinen wirklichen Ruhezustand eingehen, denn kühle Bedingungen vertragen sie nicht und müssen deshalb weiterhin bei Zimmertemperatur stehen bleiben. Die Temperaturen im Zimmer sind damit ausreichend, aber die Lichtzufuhr aufgrund der kurzen und oft bewölkten Tage im Winter eher gering. Deshalb benötigen Zimmerpflanzen im Winter deutlich weniger Wasser und Düngergaben als in den wärmeren Monaten, denn die Pflanzen reduzieren ihren Stoffwechsel merklich. Daher sollte sehr genau darauf geachtet werden wie viel gegossen wird - je nach Zimmerpflanze und deren Ansprüchen. Die Gießintervalle immer an den verringerten Bedarf der Pflanze angepasst. Im Winter gilt: besser etwas trockener als zu nass. Ein guter Anhaltspunkt dafür ist die regelmäßig durchgeführte Fingerprobe. Stecken Sie den Finger etwa 2-3 cm tief in die Erde, um den Trockengrad zu spüren. Pflanzen, die auf Fensterbänken über Heizkörpern oder in der Nähe dieser stehen, trocknen schneller aus und benötigen eventuell häufiger Wasser. Pflanzen auf kühleren Fensterbänken ohne direkte Sonneneinstrahlung aber eher weniger gießen, weil der Standort kühler ist und die Erde im Topf dadurch nicht so schnell austrocknet. Besonders wichtig ist es, generell Staunässe zu vermeiden, da diese zu Wurzelfäule führen kann. Deshalb mäßig und angepasst gießen und niemals Wasser über längere Zeit im Untersetzer oder Übertopf stehen lassen – auch um Schimmelbildung an der Erdoberfläche vorzubeugen. Heizungsluft bekommt vielen Zimmerpflanzen aus tropischen und subtropischen Gebieten oft nur schlecht, da sie an mehr Luftfeuchtigkeit gewöhnt sind. Hier hilft es, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, indem die Pflanzen regelmäßig mit kalkarmem Wasser besprüht werden.
Winterzeit ist Fortbildungszeit - Wie funktioniert ökologischer Pflanzenschutz?
Pflanzenschutz im Naturgarten fängt schon bei der der Planung und Gestaltung an. Vielfältige Strukturen und Naturgartenelemente sowie der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel sind Grundsteine für einen gesunden Garten. Die Pflanzenschutzpyramide bietet eine anschauliche Darstellung der verschiedenen Pflanzenschutzstrategien im Naturgarten. Die Basis der Pyramide bilden vorbeugende Maßnahmen wie lebendiger Boden, Förderung von Nützlingen, passender Standort, Fruchtfolge und Mischkultur. An zweiter Stelle stehen Pflanzenstärkung und eine angepasste Düngung. Eine gezielte Versorgung fördert die Widerstandskraft. Sowohl Über- als auch Unterversorgung schwächen die Pflanzen und machen sie anfälliger für Schadorganismen. Die dritte Stufe bilden die direkten Maßnahmen. Nehmen Schädlinge trotz vorheriger Strategien überhand, kann ihnen mittels Leimringen, Rückschnitt befallener Pflanzenteile, händisches Absammeln, Abspritzen mit Wasser, Unkraut jäten, gezieltem Nützlingseinsatz, Farb- oder Pheromonfallen zu Leibe gerückt werden. Die Spitze der Pyramide bilden biokonforme Pflanzenschutzmittel- als Mittel letzter Wahl können Sie zum Einsatz kommen. Die Wirkstoffe dieser Präparate müssen laut EU- Bioverordnung zugelassen sein und sind immer mit großer Achtsamkeit zu verwenden.
Buntes Treiben am Futterhäuschen – Vögel beobachten im winterlichen Garten
Meisen sind die häufigsten Wintergäste in unseren Gärten. In den frühen Morgenstunden herrscht Hochbetrieb. Nach einer langen, kalten Nacht sind die Vögel hungrig und scharren sich um die Futterstelle. Die fettreichen Sämereien sind besonders beliebt. Kohl- und Blaumeisen sind wohl die bekanntesten unter den Besuchern. Kohlmeisen sind sehr neugierig und haben kaum Scheu vor Menschen. Sie gehören zu den größten Meisenarten Europas. Die geschickten Blaumeisen balancieren gerne auf dünnen Zweigen. Beide Arten ernähren sich im Sommer hauptsächlich von Insekten. Im Winter stehen fettreiche Samen am Speiseplan. Sie verbringen nun fast 90 % des Tages mit Nahrungssuche. Haubenmeise mit ihrem unverwechselbaren schwarz-weißen Kopfschmuck, Sumpfmeise mit ihrer schwarzen Kappe und Kinnflecken und die ihr stark ähnliche Weidenmeise sowie die zierliche Tannenmeise tummeln sich ebenfalls um Meisenknödel und Fett-Futterglocke.
Das „Natur im Garten“ Telefon Oberösterreich Team
freut sich auf Ihre Gartenfragen unter:
+43 (0)732/ 772017720 oder per Mail ooe@gartentelefon.at!