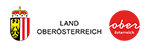Gartentipps Monat Jänner 2025
Jänner 2025

(Quelle: AdobeStock_ChristineKuchem)
Komposthaufenpflege
Das schwarze Gold (wie Kompost auch genannt wird), welches im Garten sehr begehrt ist, kann leicht selbst hergestellt werden. Damit auch alle Unkrautsamen und Krankheitserreger abgetötet werden, benötigt der Kompost eine Phase, in der es sehr heiß wird. Die Temperatur von 60 °C oder mehr, die hierfür notwendig ist, wird meistens nur in der Mitte des Haufens erreicht. Die verantwortlichen Organismen benötigen Sauerstoff und eine hohe Feuchtigkeit. Innerhalb der ersten Wochen nach dem Aufsetzen, sackt der Haufen etwas zusammen. Wenn möglich sollte der Haufen bereits hier einmal gewendet werden. Dadurch gelangen alle Inhaltsstoffe zum heißen Kern in die Mitte und die Vermischung hilft dabei, dass die Bestandsteile schneller verrotten. Um zu kontrollieren, ob der Kompost die richtige Feuchtigkeit hat, nimmt man etwas davon in die Hand und drückt es fest zusammen. Läuft Wasser heraus, ist er zu feucht. Wenn die Form nicht erhalten bleibt, ist er zu trocken. Ziehen Sie mit einem Rechen die äußere Schicht ab und setzen damit einen neuen Haufen auf. Um Temperatur wieder anzukurbeln können Sie 1 Würfel Germ und ½ kg Zucker in 1 l lauwarmem Wasser auflösen. Nach 2 Stunden geben Sie weitere 9 l lauwarmes Wasser dazu und feuchten den ganzen Kompost damit an. Auch Urgesteinsmehl und Mikroorganismen können helfen die „Heiß-Rotte“ wieder in Gang zu setzen. Die Schicht, die vorher innen war, kommt jetzt außen darauf. Achten Sie darauf, dass der Haufen luftig ist und nicht verdichtet wird. Falls zu wenig Strukturmaterial enthalten ist, können Zweige und Äste, die jetzt beim Winterschnitt anfallen, gehäckselt dazu gemischt werden. Um die Temperatur im Inneren besser von der kalten Umgebungstemperatur zu schützen, kann der Haufen mit zum Beispiel Laub abgedeckt werden. Nachdem die Temperatur unter 40°C sinkt, zersetzen unter anderem Kompostwürmer, Rosenkäfer-Engerlinge und Pilze die noch vorhandenen organischen Bestandteile.
Unterschlupf für Ohrwürmer basteln
Die Weihnachtszeit und damit auch die vielfältigen Weihnachtsbasteleien liegen schon einige Wochen zurück, aber Basteln und Heimwerken bzw. DIY (do it yourself), wie es heutzutage dem Zeitgeist entsprechend gerne genannt wird, liegt voll im Trend und auch wenn wir mitten im Winter stecken, denken viele begeisterte Naturgärtnerinnen und Naturgärtner auch jetzt schon wieder an die neue Gartensaison. Warum also nicht Garten und Basteln vereinen und gleich jetzt, wo der Garten noch ruht, für das neue Gartenjahr vorbereiten.
Möglichkeiten gibt es einige für die vielen nützlichen Tiere im Garten wie z.B. Nützlingshotels, Fledermauskästen, oder Igelverstecke.
Eine ganz einfache Bastelarbeit wären Tagesverstecke für Ohrwürmer, damit diese dann im Garten ihre Arbeit als „Schädlingseinsatztruppe“ gut erfüllen können. Künstliche Verstecke können ganz einfach hergestellt werden wie z.B. kleine Tontöpfe, die locker mit Laub oder Holzwolle befüllt werden oder auch Bambusröhrchen (zu Bündeln zusammengebunden). Diese werden dann in schattigen Bereichen oder unter dichten Sträuchern platziert und so von Ohrwürmern gerne als Tagesversteck genutzt. Wird ein Tontopf mit einer Aufhängevorrichtung versehen, kann der besiedelte Topf untertags in die Baumkrone eines Obstbaumes gehängt werden, der unter Blattlausbefall leidet. Von dort aus gehen die Ohrwürmer auf ihre nächtlichen Streifzüge und tagsüber können sie sich wieder in den Topf zurückziehen. Ohrwürmer lieben ganz allgemein alle Arten von schattigen und leicht feuchten Hohlräumen, Ritzen und Spalten. Das wären von den Naturgartenelementen her vor allem natürlichen Strukturen wie Heckensäume, wilde Ecken und Naturmaterialien wie Stein- und Asthaufen (auch in schattigeren Bereichen) und Trockensteinmauern. Auch z.B. in Gewächshäuern tummeln sich die nachtaktiven Tiere gerne, da diese immer eine gewisse Grundfeuchtigkeit aufweisen.
Kräuselkrankheit am Pfirsich - richtigen Bekämpfungs-Zeitpunkt erkennen
Wer einen Pfirsichbaum hat, wird diese unschöne Krankheit kennen. Die Rede ist von der Kräuselkrankheit (Taphrina deformans). Typisch sind die gelblichen bis rötlichen blasigen Ausstülpungen an infizierten Blättern, die sich stark kräuseln und vorzeitig abfallen. Bei starkem Befall ist der Baum schon Ende Mai kahl und treibt jedoch noch einmal aus, was ihn aber sehr viel Kraft kostet. Der Pilz, dessen Sporen über ein Jahr an der Rinde überleben können, befällt ab einer Temperatur von 10 °C die schwellenden Knospen. Um zu erkennen, wann die Knospen schwellen, können hier einzelne Knospen mit einem wasserfesten Lackstift markiert werden. Wenn sich Risse zeigen, sind die Knospen geschwollen und können behandelt werden. Zur Vorbeugung und Bekämpfung stehen verschiedene Präparate zur Verfügung, die aber genau zum richtigen Zeitpunkt ausgebracht werden müssen. Ackerschachtelhalmbrühe wird vom Knospenaufbruch bis zur Endblüte gespritzt. Präparate mit dem Grundstoff Lezithin werden ab Ende des Knospenschwellens bis kurz vor der Ernte hin angewendet.
Derzeit sind Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Kupferoxychlorid zugelassen, die nach der Ernte oder zum Zeitpunkt des Knospenschwellens verwendet werden bis maximal dem Knospenaufbruch. Behandlungen nach der Blüte sind wirkungslos.
Kupferpräparate sollten immer nur als Mittel der letzten Wahl verwendet werden, aufgrund ihrer schädigenden Wirkung für einige Bodenlebewesen, besonders Regenwürmer. Sollten sie dennoch verwendet werden, empfiehlt sich eine Bodenabdeckung mit Vlies oder Plane, um eine Auswaschung in den Boden zu verhindern.
Sind Vogeltränken auch im Winter notwendig?
Ja, Vögel müssen auch im Winter täglich trinken. Viele der natürlichen Wasserquellen, aus denen sie sich gerne bedienen, sind nun zugefroren. Damit unsere gefiederten Freunde nicht das gesundheitsschädliche salzhaltige Schmelzwasser von der Straße trinken, ist es sinnvoll den Tieren Wasser zur Verfügung zu stellen. Die verwendeten Gefäße müssen frostfest sein und für Feinde schwer erreichbar aufgestellt werden. Gut einsehbar, in der Nähe einer vogelfreundlichen Hecke, ist ein guter Platz; so können sich die Vögel bei Gefahr zurückziehen. Mehrere Wasserstellen im Garten verteilt schützen vor Infektionen und Stress. Die aufgestellten Schalen müssen eisfrei gehalten werden – zum Beispiel durch tägliches Zerstoßen der Eisschicht in Kombination mit warmem Wasser. Ein Thermophor oder ausgeklügelte Varianten mit Kerzen sind ebenso Möglichkeiten das Wasser bei Minusgraden eisfrei zu halten. Alle verwendeten Tränken sollten regelmäßig gesäubert und mit frischem Wasser befüllt werden. Kochendes Wasser mit einem Spritzer Essig eignet sich gut zur Reinigung.
Das „Natur im Garten“ Telefon Oberösterreich Team
freut sich auf Ihre Gartenfragen unter:
+43 (0)732/ 772017720 oder per Mail ooe@gartentelefon.at!